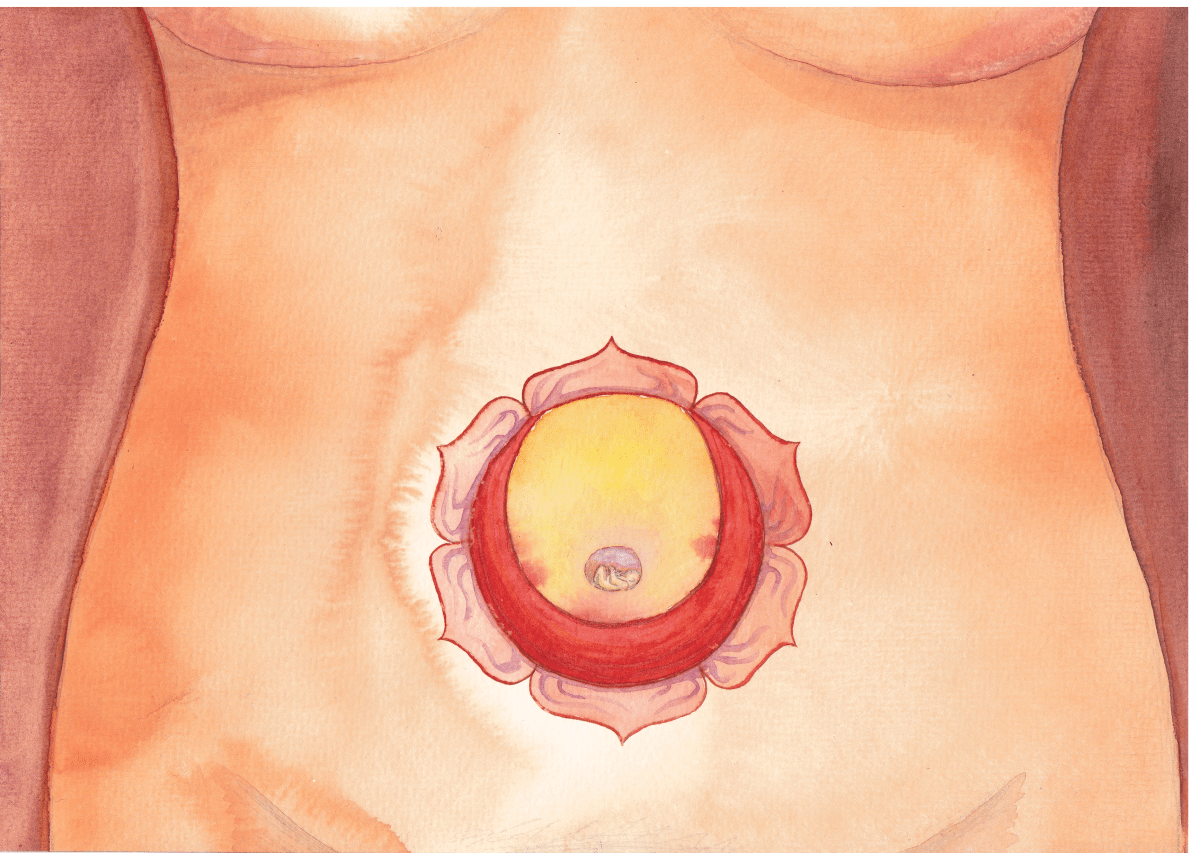In der letzten Zeit begegnet uns das Thema Vielesein und Schwangersein oder Schwangerwerden überraschend häufig, und das nehmen wir nun mal zum Anlass, von unseren eigenen Schwangerschaften zu berichten. Über die Verläufe und unseren Umgang damit. Über das, was uns geholfen hat – und was nicht. Über unsere Gefühle. Über die Fragen, die uns bewegt haben und die Lösungen, so wir sie denn gefunden haben.
Und da es dazu sehr viel zu sagen gibt, machen wir eine thematische Reihe daraus. Gerade bin ich selbst gespannt, wie viele Teile das am Ende wohl werden!
Es gibt „historisch“ gesehen viele Zeitpunkte, an denen wir inhaltlich einsteigen könnten – wir nehmen ganz pragmatisch mal den Beginn der Schwangerschaft unseres ersten lebenden Wunschkindes, und berichten in diesem Beitrag auch erstmal nur von dieser. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir die Diagnose einer DIS seit gut zehn Jahren. Wir waren Anfang 30, mit unserem Partner seit zweieinhalb Jahren zusammen, wir steckten mitten in der Abschlussphase unseres Studiums und in der Therapie waren wir gerade dabei, uns mit den Konditionierungen und der Abrichtung durch die Täterorganisation auseinander zu setzen: Der denkbar entspannteste und idealste Zeitpunkt also, schwanger zu werden!
Tatsächlich hatten wir das zu diesem Zeitpunkt seit eineinhalb Jahren versucht. Aufgrund der erlittenen Gewalt waren wir uns sehr unsicher, ob unser Körper überhaupt noch in der Lage dazu sein würde, ein Kind zu empfangen und auszutragen. Es fühlte sich nie so an, als hätten wir die Zeit, erstmal das Studium zu beenden und unsere Heilung bis zu einem bestimmten Punkt zu bringen, nachdem wir die Entscheidung für ein Kind gemeinsam mit unserem Partner grundsätzlich getroffen hatten. (Diese Überzeugung, im Leben „keine Zeit mehr für“ zu haben, und besser nicht mehr lange zu warten, gehört für uns zu den trauma-bedingten Macken, die wir halt so haben.) Der magische „Bäng!“ zwischen Spermium und Eizelle fand dann in uns zu einem Zeitpunkt statt, als wir körperlich und psychisch ziemlich am Rand waren und die Hoffnung auf „einfach schwanger werden“ gerade aufgegeben hatten. Und so musste dieser kleine, schwer ersehnte und dann doch gar nicht erwartete Minimensch in uns erstmal mit ein paar Kippen, Party und Alkohol zurechtkommen – nach zwei Jahren Vollabstinenz wollten sich einige im System endlich mal wieder was gönnen. Wir hätten uns eigentlich dann schon von dem Anspruch, als Vielemensch eine perfekte Schwangerschaft hinzulegen und eine unstressige Mutter für unser Kind zu sein, verabschieden können. Diese Erkenntnis reift in uns aber erst so ungefähr seit ein paar Monaten – und unser Kind ist jetzt 7 Jahre alt.
In der ersten Schwangerschaft sind wir nach dem Schwangerschaftstest zuhause dann am nächsten Tag gemeinsam mit dem Partner zu unserer Gynäkologin gefahren. Wir konnten es einfach noch nicht ganz glauben, und wir wollten alles richtig machen. Und mussten dann schon in der Praxis die Erfahrung machen, wie schwer es sein kann, in der Schwangerschaft auf die eigene Intuition zu vertrauen und den Körper gegen ungewollte Eingriffe von außen zu verteidigen. Wir wollten keinen vaginalen Ultraschall, weil wir wussten, wie sehr uns das stresst, und weil wir dieses fragile Vielleicht in uns möglichst wenig stören wollten. Daraufhin wollte uns die Sprechstundenhilfe wieder nach Hause schicken. Da war es gut, unseren Partner an der Seite zu haben. Und die Gynäkologin fand unseren Wunsch ganz nachvollziehbar und hat einfach einen Urin- und einen Bluttest gemacht.
Das erste Trimester mit seinen hormonellen Umwälzungen hat uns schwer zu schaffen gemacht. Wir waren durch Dinge getriggert, die wir so nicht erwartet hätten. Besonders dadurch, dass uns permanent, ohne Pause, übel war. Uns übergeben zu dürfen ist uns sehr konsequent abtrainiert worden, und tatsächlich haben wir das kein einziges Mal getan – aber wir fühlten uns konstant so, als müssten wir es jeden Moment. Wir waren unendlich müde und körperlich erschöpft. Und es gab häufige Komplikationen – heftige Unterleibsschmerzen in der 7. Woche, und eine Blutung in der 13. Woche, am Tag nach einer unserer mündlichen Diplom-Prüfungen. Eigentlich konnten wir nie ganz glauben, dass unser Körper die fragilen ersten drei Monate wirklich schaffen würde, und die Angst, das Kind verlieren zu können, hat zu sehr belastenden, sich aufdrängenden Erinnerungen geführt.
Gleichzeitig hat das Schwangersein aber auch ungeahnte Kräfte in uns freigesetzt. Es gab plötzlich ein sehr gemeinsames Ziel, nämlich, dieses Kind so sicher wie nur möglich in uns wachsen zu lassen und es zu beschützen. Jeder weitere Tag des Wachsens in uns wurde mit Staunen wegen dieses Wunders begrüßt. Plötzlich hatten wir gute Gründe, sorgsamer mit uns umzugehen und gut auf den Körper zu hören. Allein schon die Tatsache, dass wir offensichtlich heil genug waren, um schwanger werden zu können, hat dazu beigetragen, ein besseres, näheres Gefühl zu unserem Körper zu haben.
In der Therapie haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die Traumaverarbeitung ruhen zu lassen, und die Therapie vor allem dafür zu nutzen, das System in der Schwangerschaft zu stabilisieren und Begleitung und ein Gegenüber zu finden bei allen Befürchtungen und anstehenden Entscheidungen. Allerdings rührte die Schwangerschaft Erinnerungen an eine erste Schwangerschaft in der Jugend wieder auf, die durch die sexualisierte Gewalt entstanden war, dennoch von einigen Innenpersonen gewollt war, und die durch eine illegale Spätabtreibung ebenso gewaltsam beendet worden war, wie sie begonnen hatte. Die Innenperson, die damals die Schwangerschaft hauptsächlich getragen hatte, und sich als die Mutter dieses Kindes sah, hatte nun große Ängste vor einem erneuten Verlust, Angst, sich wieder an ein Kind zu binden, und es brauchte eine sehr liebevolle, achtsame und mitfühlende therapeutische Begleitung für diese Erinnerungen, und für die große Welle an Trauer, die das alles nochmal mit sich brachte. Die wachsende Liebe zu dem wachsenden Wesen in uns war oft getönt durch eine Bittersüße und Trauer, und ein wachsendes (Alltags-)Bewusstsein für und Annehmen davon, dass wir bereits eine verwaiste Mutter waren.
Wir hatten uns früh eine Hebamme gesucht, mit der wir auch die Option hatten, eine Hausgeburt zu machen, und waren ihr gegenüber von Anfang an transparent darüber, dass wir schwere sexualisierte Gewalt überlebt hatten, und auch ein erstes Kind so gewaltsam verloren hatten. Wir hatten uns jedoch dagegen entschieden, ihr von dem Vielesein zu erzählen, weil wir die Befürchtung hatten, dass diese sich dann dagegen entscheiden könnte, uns bei einer Hausgeburt zu begleiten. Und aufgrund unserer ländlichen Lage und der prekären Situation für Hausgeburtshebammen war sie unsere einzige Option für eine begleitete Hausgeburt. Unsere Gynäkologin hat uns in dieser ersten Schwangerschaft wenig gesehen. Es ist möglich, alle Vorsorgeuntersuchungen auch mit einer Hebamme zu machen – außer einem Ultraschall natürlich, aber den braucht es ja auch nicht zwingend.
Im Verlauf der Schwangerschaft wurde immer deutlicher, dass wir aufgrund eines ganzen Blumenstraußes an potentiellen Auslösern so große Ängste vor einer Geburt im Krankenhaus hatten, dass wir ganz klar eine Hausgeburt anstrebten. Trotzdem war uns klar, dass es einen Notfallplan für eine Klinikgeburt brauchte, und so erarbeiteten wir gemeinsam mit unserer Therapeutin, der Hebamme und unserem Partner eine Liste mit möglichst deutlichen Handlungsanweisungen für das Klinikpersonal, und zuoberst mit einer Erklärung darüber, dass wir an einer PTBS litten, und was das konkret für uns im Klinikkontext bedeutete.
Das zweite Trimester war im Großen und Ganzen und trotz allem wunderschön. Es war Sommer. Der Bauch wuchs, und wir konnten schon in der 16. Woche erste Kindsbewegungen spüren. Wir bestaunten unseren Körper und fanden ihn so schön wie noch nie. Die Übelkeit war weg, die Erschöpfung war auch viel weniger geworden. Es gab ein starkes Gefühl von innerer Verbindung zu dem Kind, und wir sprachen viel mit ihm, sangen ihm vor, lauschten in uns hinein. Wir schwammen fast täglich im See um die Ecke, und waren insgesamt so viel wie möglich draußen. Wir waren sehr getragen von der Beziehung zu unserem Partner, und wir festigten die Beziehungen zu anderen nahen Menschen in unserem Leben, von denen drei sogar als Co-Eltern ganz mit uns zu einer Familie zusammenwachsen wollten. Wir entwickelten positive Bilder von einer selbstbestimmten Geburt. Wir fragten eine Freundin, ob sie uns unter der Geburt begleiten wolle, und sie stimmte freudig zu. So sollte das also sein: Mit unserer Hebamme, die uns immer vertrauter wurde, mit unserem Partner und mit dieser Freundin wollten wir zuhause gebären, wenn irgend möglich im Wasser.
Wir hatten viel Unterstützung. Unser Partner, die werdenden Co-Eltern und weitere Freund*innen organisierten all die Dinge, die so gebraucht wurden. Wir hatten dadurch viel Raum, uns um uns selbst zu kümmern, und nebenbei unsere Diplomarbeit voranzutreiben, Interviews dafür durchzuführen und regelmäßig durch ein Viertel der Republik zu fahren, um das Kolloquium an der Uni zu besuchen.
Das letzte Trimester begann mit heftigen Wehen in der 28. Woche, während einer Urlaubsreise. Die beruhigten sich zwar wieder, sogar ohne Krankenhausbesuch, aber das Kind rutschte dadurch schon recht tief ins Becken, und ab dann war die Schwangerschaft körperlich ziemlich beschwerlich. Wir konnten nicht mehr den Weg zu unserer Therapeutin antreten, und weil Telefontermine sich als eher schwierig erwiesen, brach unser Kontakt zu ihr weitestgehend weg. Wir legten notgedrungen auch die Diplomarbeit erstmal auf Eis. An diese letzten Wochen kann ich mich nicht mehr sehr deutlich erinnern – ich glaube, wir waren mit unserer Aufmerksamkeit sehr auf innen gerichtet, und es wuchs Anspannung vor der Geburt. Würden wir wirklich zuhause, in gefühlter Sicherheit, gebären können? Was, wenn wir unter den Schmerzen heftig dissoziieren würden? Wie würden wir unter der Geburt sein?
Und dann kam die 34. Woche, und der Geburtstag unseres Vaters – zu dem wir damals schon seit fast zehn Jahren keinen Kontakt mehr hatten. Dennoch war dieser Tag für uns schon immer schwierig. Ich weiß nicht, ob es an der zusätzlichen inneren Anspannung lag – wir bekamen Wehen. Unsere Hebamme kam, untersuchte uns, und schickte uns unverzüglich ins Krankenhaus. Dort wurde dann vier Tage lang mit allen möglichen Mitteln noch versucht, die Geburt hinauszuzögern. Uns war am ersten Tag vor allen Dingen wichtig, dass unser Kind nicht am gleichen Tag Geburtstag haben sollte wie unser Vater – und natürlich, dass dieses Kind möglichst lebensfähig geboren werden sollte. Wir hatten so viele Ängste vor der Krankenhaussituation gehabt, und dann waren wir so konzentriert darauf, alles für dieses Kind zu tun, dass viel davon in den Hintergrund geriet. Und wir machten gute Erfahrungen mit der Begleitung durch unsere Hebamme, die uns als Beleghebamme dort weiter unterstützen durfte, und die für viel Vermittlung und Abpufferung zwischen uns und dem Routine-System Krankenhaus sorgte.
Sechs Wochen vor dem errechneten Termin wurde unsere Tochter dann letztendlich doch im Krankenhaus geboren. Es war eine spontane vaginale Geburt, und sie war trotz Krankenhaus wunderschön. (Und wir werden darüber noch einmal gesondert schreiben). Allerdings war es auch ein kleines Wunder, und ist allein dem Mut und der Erfahrung unserer Hebamme zu verdanken, dass eine Frühgeburt so selbstbestimmt, ohne ärztliche Einmischung, und nur im Kreis der Hebamme, unseres Partners, der Co-Mutter und der Freundin, im Krankenhaus stattfinden konnte. So gut wie alles an diesem Tag war ein kleines Wunder, und das größte Wunder war dann dieses knapp 40 Zentimeter kleine, weniger als zwei Kilo leichte, aber selbst atmende Zauberwesen, das uns die Hebamme schließlich in die Arme legte, und aus riesengroßen, fragenden, dunklen Kulleraugen anschaute. Das ins uns gewachsen war, nur durch unseren Körper, das wir so lange beschützt und getragen hatten, und das wir selbst in die Welt gebracht haben.
Das war nun also erstmal einfach nur die Erzählung dieser Schwangerschaft. Beim Schreiben sind uns lauter Schwerpunkte eingefallen, über die es sich sicher weiter zu schreiben lohnt: Was hat uns geholfen, die Schwangerschaft relativ selbstbestimmt zu gestalten? Und was hat dazu beigetragen, dass wir die Geburt als selbstbestimmt erleben konnten? Wie haben wir uns konkret auf die Geburt vorbereitet? Wie haben wir das mit den Innenpersonen in der Schwangerschaft geregelt? Wie sind wir mit Ängsten und Triggern umgegangen? Wie und worüber haben wir mit medizinischem Personal und anderen Helfer*innen kommuniziert, und worüber und warum bewusst auch nicht? Darüber werden wir weiterschreiben. Falls euch beim Lesen noch weitere Fragen gekommen sind, oder Anregungen, was euch konkret zum Thema Vielesein und Schwangerschaft interessieren würde, würden wir uns über entsprechende Kommentare sehr freuen.